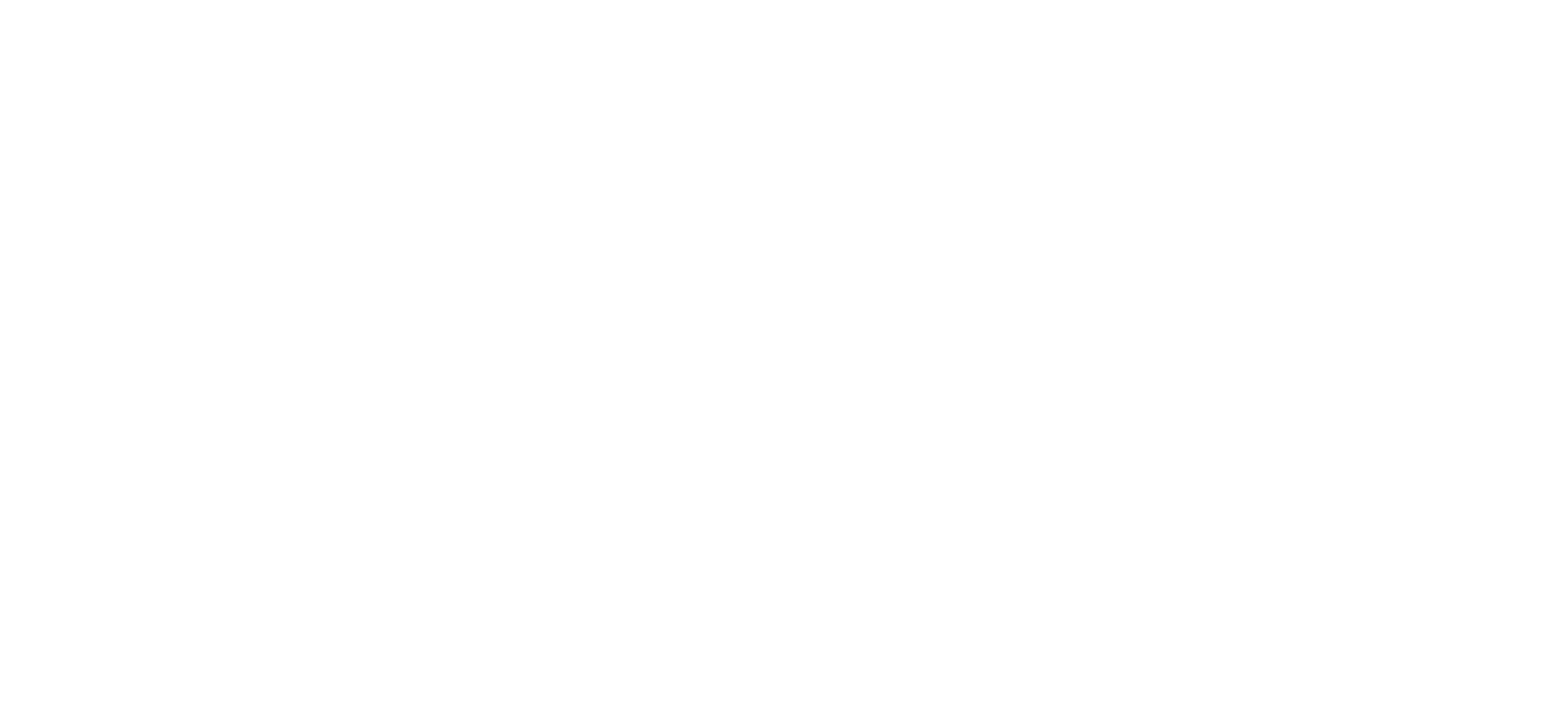| Antrag: | Das Bildungszentrum - die Schule von morgen |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Fachforum Bildung (dort beschlossen am: 24.10.2020) |
| Status: | Geprüft |
| Verfahrensvorschlag: | Übernahme |
| Angelegt: | 25.10.2020, 08:48 |
V-4-190: Das Bildungszentrum - die Schule von morgen
Von Zeile 190 bis 191 einfügen:
Alle Bildungskosten der Schüler*innen sowie Kosten für den Zugang zu Bildung(szentren) werden vom Staat übernommen. Während Lernmittel wie Bücher den Schüler*innen kostenlos ausgeliehen werden, gehen
Einleitung
Bildung ist Voraussetzung für ein friedliches und zukunftsorientiertes
Zusammenleben. In der Schule sollen durch das Erleben und Reflektieren von
Toleranz und Moral gesellschaftliche Werte gelernt werden.
Jedem einzelnen Kind soll durch Bildung ermöglicht werden, sein eigenes
Potenzial auszuschöpfen, bestmöglich zu lernen und so zu gesellschaftlicher und
politischer Teilhabe befähigt zu sein. Das primäre Ziel sollte nicht akademische
Höchstleistung sein. Wichtiger ist es, Kinder zu unterstützen, zu mündigen
Erwachsenen zu werden, die in der Lage sind, selbst zu entscheiden, welchen
Lebensweg sie einschlagen möchten. Schule muss eine solide Grundlage für das
spätere Leben schaffen und Chancen eröffnen, statt sie zu beschneiden.
Bewegungen wie “Fridays For Future” und “Black Lives Matter” zeigen, wie wichtig
eine politisierte, europäische Jugend heute ist. Sie legen offen, welche
Defizite es innerhalb der Gesellschaft gibt. Politische Bildung, Anti-
Diskriminierung jeglicher Art, Empowerment und kritisches Hinterfragen
gesellschaftlicher Normen sind unter anderem Themen, die Teil der schulischen
Bildung sein müssten.
Das aktuelle Schulsystem ist in Hinblick auf diese Zielsetzung ungeeignet. Es
fordert von Schüler*innen Anpassung an Leistungs- und Lehrnormen, statt
individuelle Besonderheiten und Stärken anzuerkennen und zu fördern. Damit
bleiben die zahlreichen Chancen unserer gesellschaftlichen Diversität ungenutzt.
Das Ziel einer homogenen Gesellschaft gilt schon lange als überholt - konträr
dazu steht der Vereinheitlichungsgedanke des deutschen Bildungssystems.
Durch das frühe Selektieren und Hierarchisieren im mehrgliedrigen System, findet
bereits im Kindesalter eine soziale Auslese statt, die nachweislich nicht nur
auf schulischer Leistung beruht. Besonders Schüler*innen mit
“Migrationshintergrund” und jene aus nicht-akademischen Elternhäusern werden in
ihren gesellschaftlichen und akademischen Möglichkeiten beschränkt. Folge dessen
ist eine doppelte Benachteiligung. Auch Lehrkräfte sind nicht frei von
Rassismen, Sexismen und Ableismen. Dennoch schreiben wir ihnen eine nicht
mögliche Objektivität bei Bewertungen zu. Diese Problematik führt dazu, dass
Menschen mit “Migrationshintergrund”, BIPoC und Menschen mit Behinderung für den
gleichen Erfolg mehr leisten müssen, als Menschen ohne diese gesellschaftliche
Zuschreibung. Statt diesen Effekt auszugleichen, wird er mit Hilfe von
selektiven Maßnahmen durch das aktuelle Bildungssystem verstärkt.
Auch Schüler*innen mit Behinderung sind in besonderem Maße davon betroffen.
Deutschland hat 2009 die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit
Behinderungen ratifiziert. Aus Artikel 24 UN-BRK geht die Verpflichtung hervor,
Menschen mit Behinderung im Regelschulsystem inklusive Bildung zu gewährleisten.
Mehr als zehn Jahre später besuchen viele von ihnen aber weiterhin
Förderschulen. Dort haben sie nur geringe Chancen auf einen Regelschulabschluss.
Außerdem kommen Schüler*innen mit Behinderung weniger mit Schüler*innen ohne
Behinderung in Kontakt. So wird die gesellschaftliche Marginalisierung von
Menschen mit Behinderung verstärkt und beiden Seiten das Recht auf ein
gesellschaftliches Miteinander geraubt.
Das Ziel einer homogenen Leistungsgruppe ist nicht nur unerreichbar, vor allem
verhindert es sozialen Austausch und forciert vergleichende Tendenzen innerhalb
der Lerngruppe. Der Leistungsgedanke, der dem Schulsystem zugrunde liegt und
sich in Ziffernnoten und Numerus Clausus ausdrückt, führt nachweislich zu
psychischen Belastungen und kann psychische Erkrankungen begünstigen oder
verursachen. Schüler*innen werden durch Ziffernnoten in ihren akademischen
Möglichkeiten beschnitten und stehen unter Leistungsdruck. Statt für
Vergleichbarkeit zu sorgen, verstärken sie Ungleichheit. Denn Ziffernnoten
täuschen eine objektive Vergleichbarkeit vor, die es nicht geben kann.
Lehrkräfte sind wie alle Menschen von Erfahrungen, Vergleichen, Stimmungslagen
uvm. geprägt und Kompetenzen sind hoch komplex und individuell.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leiden unter dem im Kapitalismus immer
präsenten Leistungsdruck und Wettbewerb. Das Effizienz- und Leistungsstreben,
das in unserer Gesellschaft als Normalzustand angenommen wird, darf nicht
Grundlage der schulischen Bildung sein. Schüler*innen müssen sich frei von Lern-
und Leistungsdruck individuell entwickeln dürfen. Diese Vielfalt muss sich auch
in den Lernräumen und Unterrichtsinhalten wiederfinden. Nur durch eine
umfassende Demokratisierung des Schulsystems werden Lernräume und
Unterrichtsinhalte Spiegel der Interessen der Schüler*innen.
Eine zukunftsorientierte, inklusive Schule kann nicht ohne Digitalisierung
auskommen. Digitale Kompetenzen sind wichtige Voraussetzungen für die
Arbeitswelt. Die digitale Welt bietet viele, oft ungenutzte Potenziale, vor
allem im Bereich der Teilhabe.
Das aktuelle Bildungssystem basiert auf Bildungsföderalismus und Ziffernnoten
genauso wie auf Selektion und Schüler*innen-Lehrkräfte-Hierarchie. Einzelne
herausragende Schulen und kontinuierliche Reformen können die schwerwiegenden
strukturellen Fehler des deutschen Bildungssystems nicht ausgleichen.
Selbstbestimmung, Freiheit, Chancengleichheit sowie Emanzipation und
Partizipation der Schüler*innen können nur durch einen grundlegenden Neuentwurf
des Schulsystems erfolgen.
Aufgrund dieser Erkenntnisse fordert die GRÜNE JUGEND die Ersetzung der Schule
in ihrer heutigen Form zugunsten der Einführung des gut finanzierten inklusiven,
demokratischen, digitalen, flexiblen, zukunftsorientierten, europäischen und
sich stetig weiterentwickelnden Bildungszentrums.
Grundkonzept
Das Bildungszentrum wird von allen Kindern bis jungen Erwachsenen mindestens
zehn Jahre lang besucht. Das Bildungszentrum ist eine gebundene
Ganztagsinstitution. Die Schüler*innen sind in heterogenen Stammgruppen
organisiert. In diesen lernen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Der
Fokus liegt auf einer engen Zusammenarbeit und individuellen Förderung der
Schüler*innen. Bei allen Entscheidungen werden alle beteiligten Akteur*innen
demokratisch einbezogen. Die Schüler*innen wählen sich ihre Unterrichtsthemen
innerhalb eines vorgegebenen Rahmens selbst aus und bearbeiten diese zunehmend
selbstständig. Alle notwendigen Kosten der Schüler*innen werden vom Staat
übernommen. Es gibt keine dogmatischen Ferienzeiten. Stattdessen beantragen die
Schüler*innen Urlaub.
Die Rahmenbedingungen für das Bildungszentrum schafft der Bund. Die genaue
Ausgestaltung erfolgt auf Ebene der einzelnen Bildungszentren. Dabei orientieren
sie sich an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es finden zudem
regelmäßige Evaluationen hinsichtlich der Lehrmethoden innerhalb der
Bildungszentren statt.
Nach zehn Jahren haben die Schüler*innen drei Optionen: Sie können mit einer
Ausbildung beginnen oder noch länger im Bildungszentrum bleiben. Für einige
Schüler*innen ist es zudem sinnvoll, schon mit einem Studium zu beginnen.
Gesetzgebung
Der Bund schafft für die Bildungszentren entsprechende Rahmenbedingungen. Der
Freiraum innerhalb des Rahmens ermöglicht eine größtmögliche Selbstbestimmung
aller am Bildungszentrum Beteiligten.
Gleiche Rahmenbedingungen
Dem Bund fallen die Verwaltung, die Finanzierung, die Vernetzung der
Bildungszentren und die Ausarbeitung eines Kerncurriculums zu. Außerdem arbeitet
der Bund mit den anderen Ländern der Europäischen Union mit dem Ziel einer
einheitlichen europäischen Bildungspolitik zusammen. Der Gesetzgebung des Bundes
müssen die Bundesländer über den Bundesrat zustimmen.
Dezentrale Entwicklungsmöglichkeiten
Die genaue Ausgestaltung erfolgt auf Ebene der einzelnen Bildungszentren. Dazu
gehören die Gestaltung der Lernräume und die konkreten Entscheidungsstrukturen.
Innerhalb klarer Vorgaben werden zudem thematische Schwerpunkte gesetzt.
Örtliche und kulturelle Besonderheiten werden dabei ebenso wie für sonstige
Gestaltungsentscheidungen miteinbezogen. Im Bildungszentrum treffen
Schüler*innen und Lernbegleitende grundsätzlich alle Entscheidungen
demokratisch. Je nach Schüler*in und Thema können auch Erziehungsberechtigte mit
in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Bestimmte Entscheidungen, wie die
thematische Fokussierung in der Erstellung der individuellen Lernpläne, liegen
bei den einzelnen Schüler*innen.
Unterrichtsgestaltung
Im Bildungszentrum wechseln sich konzentrierte, körperlich aktive, kreative und
entspannte Phasen ab (rhythmisierter Ganztag). So werden geistig aktive Zeiten
genutzt und durch körperliche Aktivitäten unterstützt. Die täglichen
Bildungszeiten orientieren sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum
natürlichen und individuellen Biorhythmus von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Vor und nach den regulären Unterrichtszeiten gibt es die
Möglichkeit der Betreuung, wenn dies von Schüler*innen bzw.
Erziehungsberechtigten gewünscht wird.
In der konkreten Unterrichtsgestaltung besteht großer Freiraum, sodass sie auf
Schüler*innenschaft und Lernbegleitende passgenau abgestimmt werden kann. An
erster Stelle steht das Ziel, die Schüler*innen individuell dabei zu
unterstützen, zu mündigen, selbstlernenden, kritischen und sozialen Menschen zu
werden. Im Bildungszentrum geht es deshalb vorrangig um die Vermittlung von
(sozialen) Kompetenzen. Die Fähigkeit, Informationen kritisch einzuordnen und zu
hinterfragen sowie eine eigene Meinung auszubilden und diese vertreten zu
können, steht dabei stärker im Fokus als die reine Wissensvermittlung.
Gemeinsames Forschen
Die Schüler*innen sind vorrangig in kleinen alters- und leistungsheterogenen
Stammgruppen organisiert. In geeigneten Unterrichtseinheiten lernen mehrere
Stammgruppen gemeinsam bzw. in neu zusammengesetzten Konstellationen. So kann
ein Austausch zwischen verschiedenen Schüler*innen und über verschiedene
Altersstufen hinweg stattfinden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der
gegenseitigen Unterstützung von leistungsstärkeren und leistungsschwächeren
Schüler*innen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Schüler*innen ihre
Lehrkräfte schulen, um individuelle Erfahrungen zu teilen und ein Lernen auf
Augenhöhe zu erreichen. Davon abgesehen finden auch Einheiten, in denen sich die
Lerngruppen nach Interessen zusammensetzen, statt.
Der Fokus des Lernens liegt auf problem- bzw. lösungsorientierter und kreativer
Projektarbeit, in der Wissen und Kompetenzen durch eigene Praxiserfahrungen und
Recherchearbeit erarbeitet werden. Die Stammgruppen beschäftigen sich immer mit
einem Thema, welches sie u.a. aus naturwissenschaftlicher, sprachlicher,
geographischer, gesellschaftskritischer, historischer, künstlerischer, ethischer
oder auch psychologischer und philosophischer Sicht kritisch betrachten. Wo
möglich wird mit allen Sinnen gelernt.
Das Bildungszentrum weist eine Ausstattung auf, die es den Schüler*innen selbst
ermöglicht, aktiver Teil einer lebendigen Institution zu sein. Schüler*innen
bringen sich beispielsweise selbst in der Organisation einer Cafeteria oder
eines Kiosks ein, aber auch die Technik, der Garten und das sonstige Gelände
weisen eine Ausstattung auf, die den Schüler*innen Möglichkeiten bietet, sich
auszuprobieren.
Regionale Bildungslandschaften
Zum praxisnahen Lernen gehört, dass das Bildungszentrum zur Außenwelt hin offen
ist. So werden für Projekte Exkursionen von den Schüler*innen (mit-)organisiert
oder Expert*innen, Zeitzeug*innen, Berufstätige oder auch Künstler*innen aus den
jeweiligen Fachgebieten eingeladen. Dabei findet immer eine kritische
Auseinandersetzung mit deren Tätigkeiten, Werten und Weltanschauungen statt.
Durch Vernetzung mit und Unterstützung durch andere Bildungsträger sowie
Institutionen und Unternehmen der Region werden regionale Bildungslandschaften
geschaffen.
Selbstbestimmung und Freiheit
Alle Schüler*innen haben ihre individuellen Lernpläne, die sie auf Grundlage der
eigenen Fähigkeiten und Interessen gemeinsam mit Lernbegleitenden erstellen und
eigenverantwortlich innerhalb der Zeiten des Bildungszentrums bearbeiten. Ihnen
obliegt die Wahl der Bearbeitungsgeschwindigkeit, des Lernortes innerhalb des
Bildungszentrums und der Lernpartner*innen. Die Lernbegleitenden beraten die
Schüler*innen regelmäßig und individuell bei der Erstellung ihrer Lernpläne. Sie
stehen den Schüler*innen zur Unterstützung und fachlichen Hilfe beiseite. Auch
erkennen sie, wenn sich Schüler*innen Leistungsdruck selbst auferlegen und
versuchen, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie mit diesem umgehen. Ebenso motivieren
sie zur Beschäftigung mit neuen Themen. Sie stellen den Schüler*innen die
gewünschten Materialien zur Verfügung. Diese dürfen zur freiwilligen Vertiefung
auch mit nach Hause genommen werden, eine verpflichtende Bearbeitung
(Hausaufgaben) gibt es nicht. Außerdem regen sie die Schüler*innen zu einem
sensiblen gemeinschaftlichen Miteinander ohne Ausgrenzung und zur Schaffung
entsprechender Strukturen unter den Schüler*innen an.
Die Schüler*innen erhalten ein Kontingent an Urlaubstagen. Sie entscheiden, wann
sie ihren Urlaub nehmen wollen. Dafür beantragen sie die Urlaubszeiten.
Bildung ist kostenlos
Alle Bildungskosten der Schüler*innen sowie Kosten für den Zugang zu Bildung(szentren) werden vom Staat übernommen. Während
Lernmittel wie Bücher den Schüler*innen kostenlos ausgeliehen werden, gehen
andere Lernmittel wie digitale Endgeräte in den Besitz der Schüler*innen über.
Sie dürfen von den Schüler*innen auch privat genutzt werden.
Multiprofessionelle Lernbegleitende
Im Bildungszentrum werden die Kinder bis jungen Erwachsenen beim Lernen von
einem multiprofessionellen Team begleitet. Diesem gehören Fachkräfte aus den
Bereichen Pädagogik, Therapie, Logopädie, Psychologie sowie weiteren
Fachbereichen an. Mehrere Mitglieder des multiprofessionellen Teams koordinieren
eine Stammgruppe. Das Zentrum ermöglicht und erwartet von den Lernbegleitenden
eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Deshalb werden hochwertige Fortbildungen
besucht. Teambesprechungen finden regelmäßig statt. Es findet ein Austausch über
Lehrmethoden statt, aber auch entsprechende Materialien werden stets geteilt.
Ergänzend findet ein Austausch mit Lernbegleitenden aus anderen Bildungszentren
statt. Die Lernbegleitenden diskutieren stammgruppenübergreifende Probleme sowie
Erfolge und Vorgänge innerhalb einer Stammgruppe. Im multiprofessionellen Team
werden Kollaboration und Kooperation gelebt. Regelmäßig finden
Unterrichtsbesuche zur Evaluation und qualitativen Weiterentwicklung des
Unterrichts statt.
Zur Aufgabe der Lernbegleitenden gehört auch, für Schüler*innen, die
beispielsweise aufgrund von Krankheit nicht ins Bildungszentrum kommen können,
Bildungsangebote zu schaffen und soziale Kontakte während der Abwesenheit zu
fördern sowie die Wiedereingliederung frei von Stigmatisierung zu ermöglichen.
Pflegekräfte und weiteres Personal, das nicht Teil der Lernbegleitenden ist,
wird über das Bildungszentrum angestellt. Es wird sinnvoll in die Arbeit des
multiprofessionellen Teams eingebunden.
Digitalisierung
Medienkompetenz ist zentral für das Leben im 21. Jahrhundert. Digitale Medien
unterstützen die Inklusion und bieten vielfältige Optionen zur differenzierten
Unterrichtsgestaltung und Ansprache der Schüler*innen auf verschiedenen Ebenen
und somit einen Mehrwert. Deshalb werden sie eng mit analogen Medien verknüpft,
ersetzen diese aber nicht in allen Fällen.
Chancen der Digitalisierung aufgeklärt nutzen
Den Risiken digitaler Medien wird mit Aufklärung begegnet. Das Bildungszentrum
ist zentraler Ort zur Sensibilisierung und Prävention: Im Bildungszentrum wird
der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten, Gefahren durch Betrug
sowie der Umgang mit Pornografie und Gewalt im Internet besprochen und kritisch
diskutiert. Die Lernbegleitenden sensibilisieren die Schüler*innen für das
Suchtpotential sozialer Medien und Spiele und geben ihnen Strategien zu
selbstschützendem Verhalten mit auf den Weg.
Fortbildungen zur Digitalisierung
Um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können, werden alle
Lernbegleitenden regelmäßig im Umgang mit digitalen Medien fortgebildet. Da die
meisten Schüler*innen bereits mit digitalen Medien aufwachsen, bieten sich
Schulungen für Lernbegleitende auch durch interessierte Schüler*innen in diesem
Bereich besonders an.
Lernräume
Das Bildungszentrum ist kultureller Mittelpunkt und Lebensort. Damit trägt es
eine hohe Verantwortung hinsichtlich des Wohlbefindens und der psychischen
Gesundheit. Die Architektur und Einrichtung der physischen Lernräume des
Bildungszentrums richtet sich nach dem Wohl der Schüler*innen und deren
erfolgreichen Lern- und Entwicklungsprozessen. Die Schüler*innen beteiligen sich
an der Wahl der Ausstattung und Gestaltung der Räumlichkeiten. Um zügig und ohne
großen Aufwand die Lernumgebung umzugestalten, ist ausreichend Platz in den
Räumen vorhanden und die Möbel sind leicht und flexibel einsetzbar. Eine
angemessene Versorgung mit Strom und Internet ist die Voraussetzung für den
Einsatz digitaler Medien.
Pädagogische Architektur
Die Architektur der verschiedenen Gebäudeteile und Räume ist vielfältig und
dynamisch. Sie orientiert sich in der Form an der geplanten Nutzung. Die
Aufteilung auf verschiedene größere und kleinere Gebäudeeinheiten ist dazu
beispielsweise eine gute Möglichkeit. Die Räume bieten viel Licht und sind
ästhetisch nach Wunsch der Schüler*innen und des Personals gestaltet.
Das Gebäude wird dabei als einheitlicher Komplex begriffen, in dem die einzelnen
Teile ein Zusammenspiel ergeben. Wenn Lerngruppen und Schüler*innen flexibler in
der Raumwahl werden, dann spiegelt sich dies auch in der Architektur wieder. So
gibt es Orte, an denen große Gruppen zusammenkommen können, Räume für
Kleingruppen und ruhige Plätze, die der Einzelarbeit dienen. Die Räume sind
zudem offen bzw. verbunden und halten durch ausgeklügelte Akustik-Konzepte die
Geräuschkulisse auf einem angenehmen Niveau. Auch die Flure sind Teil des Lern-
und Lebensraumes und entsprechend gestaltet.
Lernlandschaften für eine Entwicklung in Eigenverantwortung
Hinsichtlich der Nutzung der Einrichtungsgegenstände wird den Schüler*innen
größtmögliche Freiheit eingeräumt. Es gibt frei zugängliche digitale Medien,
Lehr- und Lernmaterialien, Sportgeräte und Spielzeuge. Wo eine Kontrolle der
Nutzung nötig ist, wird diese grundsätzlich durch Schüler*innen selbst
übernommen. Es gibt ausreichend bequeme und ansprechend gestaltete
Sitzmöglichkeiten.
Die Räume werden flexibel und entsprechend der Lehrmethoden genutzt. Denkbar ist
eine Nutzung mehrerer Unterrichtszimmer für jeweils ein eigenes Thema, um auf
diese Weise Lernlandschaften zu entwickeln. Dabei können die Räume auch Aufgaben
auf unterschiedlichen Niveaus anbieten.
Im Bildungszentrum gibt es zudem Erholungsräume sowie Schutz- und Rückzugsräume,
die von den Schüler*innen bei Bedarf freiwillig aufgesucht werden können. Für
die Lernbegleitenden gibt es eine ausreichend große Anzahl an größeren und
kleineren Räumen, die für regelmäßig stattfindende Besprechungen der
multiprofessionellen Teams, für die Unterrichtsvorbereitung, aber auch als
Ruheräume genutzt werden können.
Ökologisches Vorbild und kultureller Mittelpunkt
Das Bildungszentrum erzeugt mehr Energie als es verbraucht. Die Innen- wie die
Außenräume sind reich an Bepflanzungen.
Abends werden die Räumlichkeiten des Bildungszentrums für Bildungs- und
Unterhaltungsveranstaltungen genutzt sowie für Kultur und Sport. Dabei ist das
Zentrum grundsätzlich allen Menschen zugänglich.
Entwicklungsreflexion und Abschluss
Wertschätzende Entwicklungsreflexion sowie Entwicklungsausblicke bilden die
Grundlage für ein motivierendes, förderndes Umfeld. Eine individuelle Evaluation
lässt Schüler*innen die Freiheit, Präferenzen nach eigenem Ermessen auszubauen
und Schwächen im persönlichen Tempo und ohne Druck von außen aufzuarbeiten.
Leistungs- und Lerndruck werden durch Wertschätzung und Hilfestellungen
aufgefangen.
Voraussetzung dafür ist, dass Schüler*innen und Lernbegleitende sich
grundsätzlich im Austausch über Didaktik, Inhalte des Unterrichts sowie
beiderseitige Leistung befinden. Regelmäßig finden persönliche Gespräche über
den aktuellen Lern- und Entwicklungsstand statt. Diese sollen der Rückmeldung
der Leistung der Schüler*innen, aber auch der Lernbegleitenden dienen. Das
Lehrpersonal nutzt die gewonnenen Informationen, um die Schüler*innen
individuell zu unterstützen.
Individuelle Entwicklungsberichte
Halbjährlich erhalten die Schüler*innen Entwicklungsberichte, die ohne
Ziffernnoten auskommen. Diese sind in einer für die*den individuelle*n
Schüler*in verständlichen Form festgehalten. Ziel der Entwicklungsberichte ist,
die Schüler*innen auf ihrem individuellen Lernweg zu unterstützen, ohne
Leistungsdruck aufzubauen.
Die Entwicklungsberichte bestehen aus themenübergreifenden Rückmeldungen, die
nicht nur die individuellen Leistungen enthalten, sondern auch die persönliche
Entwicklung, die Motivation und das soziale Engagement der Schüler*innen
würdigen. Entwicklungsberichte werden persönlich im Lernbegleitende*r-
Schüler*in-Gespräch besprochen. Hier bleibt Raum für beiderseitige
Verbesserungsvorschläge sowie Lob. Von besonderer Bedeutung ist, dass die
Lernbegleitenden die Selbsteinschätzungen der Schüler*innen einholen, um etwaige
Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Schüler*innen zu
behandeln.
Selbstbestimmter Abschluss und persönliche Zulassungsverfahren
Die Schüler*innen entscheiden selbst, wann sie ihre - mindestens zehnjährige -
Laufbahn im Bildungszentrum beenden wollen. Zur Beendigung erhalten sie einen
schriftlichen Abschlussbericht, dessen Erhalt an keine weiteren Bedingungen
geknüpft ist. Dieser kommt ohne Zensuren aus, fasst die Bildungsbiographie der
Schüler*innen zusammen und benennt die Kompetenzen der Schüler*innen. Mit diesem
können sich die ehemaligen Schüler*innen auf Ausbildungs- und Studienplätze
bewerben. Dort absolvieren sie Aufnahmeverfahren, die berufsbezogene bzw.
studienbezogene Kompetenzen und Interessen prüfen.
Demokratie
Demokratische Strukturen finden sich auch im Bildungszentrum wieder.
Schüler*innen lernen im Bildungszentrum nach ihrem Interesse und in ihrer
Geschwindigkeit. Das kann nur durch demokratische Strukturen gewährleistet
werden. Diese dienen dabei nicht nur als Interessenvertretung innerhalb des
Bildungszentrums, sondern lehren auch Demokratieverständnis und Zusammenhalt und
unterstützen die Schüler*innen in Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Ausgeglichene Machtverhältnisse und Partizipation aller Beteiligten
Im Bildungszentrum sind die Machtverhältnisse ausgeglichen. Das
Schüler*innenparlament ist neben der Lernbegleitendenkonferenz mit
weitreichenden Kompetenzen ausgestattet.
Engagement im Schüler*innenparlament wird von den Lernbegleitenden gefördert
sowie in Entwicklungsberichten gewürdigt.
Lernbegleitendenkonferenzen werden grundsätzlich unter Anwesenheit von
Schüler*innen abgehalten, um Transparenz und Mitbestimmung zu fördern. Je nach
Thema wird für Entscheidungen, wie beispielsweise die Gestaltung des
Außenbereichs und des Unterrichts, eine bestimmte Mehrheit innerhalb des
Schüler*innenparlaments benötigt.
Teilhabe der Schüler*innen am Unterrichtsaufbau
Das Grundgerüst des Unterrichtsaufbaus wird in Zusammenarbeit zwischen
Lernbegleitenden und dem Schüler*innenparlament ausgearbeitet. Konkrete
gemeinsame Unterrichtsinhalte sowie Didaktik werden dann im Rahmen des
Curriculums innerhalb der Stammgruppe demokratisch abgestimmt. Wo möglich dürfen
einzelne Schüler*innen oder Gruppen innerhalb der Lerngruppe selbst über ihre
Themen und Lernmethoden bestimmen.
Schüler*innenhilfen und Konfliktlösung
Freiwillige Schüler*innenhilfen dienen als erste Ansprechpartner*innen für die
Schüler*innen. Probleme, Konflikte und Fragen können so untereinander gelöst
werden. Bei Bedarf können Lernbegleitende hinzugezogen werden. Sie nehmen dann
eine beratende Funktion ein oder dienen als Mediator*innen.
Schüler*innenrat
Die Schüler*innen einer Stammgruppe setzen sich regelmäßig als Schüler*innenrat
zusammen. Dieser ermöglicht ihnen gegenseitige Hilfe, Raum für Konfliktlösung
und bietet eine Diskussionsplattform. Es können beispielsweise Themen besprochen
werden, die das Miteinander, den Unterrichtsinhalt oder dessen Gestaltung
betreffen. Ebenso können Ausflugsplanungen und Vorschläge ausgearbeitet werden.
Dafür steht dem Schüler*innenrat ein Budget zur Verfügung, über das er
grundsätzlich frei entscheiden kann.
Unterrichtsinhalte
Schüler*innen verlassen das Bildungszentrum als kritische Weltbürger*innen. Dazu
stellt das Bildungszentrum die zentralen Weichen.
Bemündigung zur gesellschaftlichen Mitsprache
Die frühzeitige sozialethische, gesellschaftliche und politische Mitsprache als
mündiger Mensch setzt voraus, sich schon im Bildungszentrum mit entsprechenden
Fragen auseinanderzusetzen. Von besonderer Bedeutung sind dabei aus heutiger
Sicht folgende Themen:
- Demokratie
- Kapitalismus
- Patriarchat und heteronormative Gesellschaft
- Sexismus, Geschlechterrollen und Gender
- Rassismus
- Organisationstheorien
- Klima-, Umwelt- und Naturschutz
- Extremismus mit Fokus auf Rechtsextremismus
- Kolonialismus und Expansionspolitik
Weltanschauungen kritisch betrachten
Alle Schüler*innen beschäftigen sich unabhängig von der eigenen Konfession mit
den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Diese werden dabei von
verschiedenen Seiten beleuchtet. Einen besonderen Raum nimmt die Beschäftigung
mit Werten, Normen und Verhaltensweisen ein. Dabei werden die Schüler*innen
besonders zur Selbstreflexion ermuntert.
Diversität der Quellen
Eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart wird hergestellt
und diskutiert. Die Unterrichtsinhalte werden immer aus verschiedenen
Perspektiven betrachtet. Bei der Quellenauswahl wird auf Diversität geachtet.
Die Sichtweise von marginalisierten Gruppen wie F*IT-Personen, LGBTQIA+,
Menschen mit Behinderung, Schwarzen Menschen und People of Color oder von Armut
betroffenen Menschen sind genauso fester Bestandteil des Unterrichts wie die
außereuropäische Perspektive.
Psychische Gesundheit
Psychische Erkrankungen sind starke Hemmnisse einer guten Bildung und
Selbstverwirklichung. Sie führen zu Fehlzeiten und können zu Suiziden führen.
Deshalb wird psychischen Erkrankungen im Bildungszentrum aktiv entgegengewirkt.
Prävention und stigmatisierungsfreier Umgang
Zum multiprofessionellen Team gehören Psycholog*innen. Sie stehen jederzeit als
Ansprechpersonen für alle Beteiligten zur Verfügung und schulen diese
regelmäßig.
Im Unterricht wird der hohe Stellenwert psychischer Gesundheit allgemein sowie
einzelner Krankheitsbilder thematisiert. Eine spezifische Stärkung der Resilienz
findet statt. Risikofaktoren für die psychische Gesundheit wird aktiv
entgegengewirkt, indem gegen Mobbing und Menschenfeindlichkeit im Alltag
gearbeitet wird.
Auf Menschen mit psychischen Erkrankungen wird besonders Rücksicht genommen und
die Lernpläne werden stetig an die aktuelle Situation angepasst. Das Thema
psychische Gesundheit wird in den Gesprächen zwischen Schüler*innen und
Lernbegleitenden thematisiert. Den Schüler*innen werden Angebote zur Hilfe
unterbreitet. Schüler*innen und Angestellte erhalten geeignete Hilfe frei von
Stigmatisierung.
Hilfe über das Bildungszentrum hinaus
Das multiprofessionelle Team arbeitet mit Kinder- und
Jugendpsychotherapeut*innen und Psychiater*innen außerhalb des Bildungszentrums
zusammen, um eine bestmögliche Unterstützung innerhalb des Bildungszentrums zu
gewährleisten. Eine Weitergabe von persönlichen Daten findet nur auf
ausdrücklichen Wunsch der Person oder bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung
statt. Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen finden außerhalb des
Bildungszentrums statt.
Weiterentwicklung
Die Schilderungen dieses Beschlusses ergeben sich aus der aktuellen Perspektive
und sind weder statisch noch alternativlos zu verstehen. Das Bildungszentrum
entwickelt sich stetig weiter. Grundlage dafür sind wissenschaftliche
Erkenntnisse sowie die Einschätzungen der Schüler*innen und Lernbegleitenden.
Besonders wichtig ist, dass Unterrichtsinhalte auf ihre Aktualität geprüft und
dem Zeitgeschehen angepasst werden.