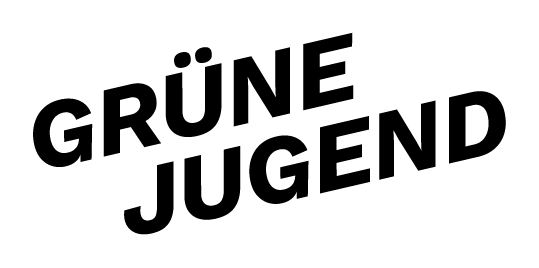| Veranstaltung: | 1. Länderrat 2025 |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | 3. Anträge |
| Status: | Beschluss |
| Beschlossen am: | 08.07.2025 |
| Antragshistorie: | Version 2 |
Schluss mit der Bildungskrise! Für einen Aufbruch in eine neue Bildungspolitik in den Kommunen.
Beschlusstext
Als Jugendverband müssen wir in den Kommunen Bildung zu einem zentralen Schwerpunkt machen – denn in den letzten Wahlkämpfen fand Bildungspolitik
wenig Beachtung. Dabei ist sie eine essenzielle Chance: Sie wirkt sich statistisch stark auf die Einkommen, Lebensverhältnisse und Zufriedenheiten der
Bürger*innen einer Kommune aus. Oft werden Schulen wie eine Lernfabrik verwaltet, was zahlreiche Probleme mit sich bringt. Doch viele Kommunen und
Schulen haben gezeigt, dass innovative pädagogische Ideen nachhaltig positiv wirken können.
Dieser Antrag soll Kreis- und Landesverbänden eine inhaltliche Orientierung zu Fragen bei kommunaler Bildungspolitik geben. Er kann auch für kommende
Wahlprogrammprozesse für Kommunalwahlen genutzt werden. Der Antrag erkennt an, dass Bildungspolitik in jedem Bundesland oder Kommune unterschiedlich
funktioniert und die Umsetzung vor Ort sehr unterschiedlich ist. Dieser Antrag bleibt also nur eine grobe Richtschnur und muss vor Ort mit Leben
gefüllt werden.
Bildung betrifft uns alle. Lasst sie uns wieder auf die Karte setzen!
Schulgebäude
Schulräume müssen ausreichend Platz bieten sowie schallreduziert und ganzjährig angenehm temperiert sein. Eine gute Belüftung und trockene
Raumverhältnisse sind essenziell für konzentriertes Lernen. Schulen müssen saniert werden. Gefahrenquellen wie bauliche Mängel oder herabfallende
Elemente müssen konsequent beseitigt werden. Schüler*innen verbringen bis zu 15.000 Stunden in der Schule, Lehrkräfte ihr gesamtes Berufsleben – die
Umgebung muss daher inspirierend gestaltet sein. Licht, Farben und Ausstattung sollten eine angenehme Atmosphäre schaffen und müssen barrierearm
ausgestaltet werden. Außerdem benötigt es neben den Unterrichtsräumen auch Begegnungsorte, die soziale Interaktion ermöglichen. Schulen benötigen
offene und geschlossene Lernbereiche für unterschiedliche Bildungsformen. Werkstätten, Gärten, Experimentallabore, Bühnen und Ateliers sollten ebenso
vorhanden sein wie Räume für Gruppen- und Einzelarbeit. Betonflächen müssen durch grüne, ansprechend gestaltete Schulhöfe ersetzt werden. Vielfältige
Spiel- und Sportmöglichkeiten sollen den Schüler*innen zur freien Nutzung bereitstehen. Moderne Hard- und Software muss für alle Schüler*innen
zugänglich sein. Smartboards oder Flatscreens sollten in allen Unterrichtsräumen vorhanden sein. Zudem müssen Computer mit aktueller Lernsoftware und
Office-Programmen frei nutzbar sein. Außerdem müssen unsere Schultoiletten für alle nutzbar sein. Dazu gehört die barrierefreie Ausstattung,
kostenfreie Periodenprodukte und immer komplett geschlossene Kabinen, die ein Störung der Privatsphäre verhindern. Schulen sollen sich dem Umfeld
öffnen. Nachmittagsangebote außerschulischer Träger können in Schulräumen stattfinden.
Das Hauptproblem bei der Erfüllung des Ganztagsanspruchs ab 2026 sind mangelnde Raum- und Platzkapazitäten sowie die fehlenden Liegenschaften. Mensen
und Aufenthaltsräume müssen auch in Freistunden einladende Orte für Schüler*innen sein, um Lernen und soziale Interaktion zu ermöglichen. Nach
Möglichkeit sollen für das Ganztagsangebot gesonderte Räume zur Verfügung gestellt werden, die den Anforderungen des Ganztags gerecht werden. Gerade
in (Groß-) Städten sind Flächen für neuen Schulbau knapp. Bestandsumbau, vor allem in die Höhe, sollte gefördert werden. Zur Erhaltung der Grauen
Energie, der Gesamtheit der für den Bau benötigten Ressourcen, sollte der Lebensdauerzyklus eingerechnet werden. Anmietung kann auch eine Option sein,
wobei es oft günstiger ist, wenn die Stadt Eigentümerin des Schulgebäudes und des Grundstücks ist. Gleichzeitig sollen Anforderungskriterien auferlegt
werden, die sich an der Nachhaltigkeit ausrichten. In Zeiten der Klimakrise bedeutet dies beispielsweise Bauen mit nachhaltigen Rohstoffen,
Passivhausstandard, Begrünung und PV-Anlage auf dem Dach. Auch umfassende Barrierearmut ist kein Nice-to-have, sondern Standard in der Schule der
Zukunft.
Mittagessen
Zu einem gesunden und erfolgversprechenden Schul- und Kitaalltag gehört ein gesundes Mittagessen. Kein Kind soll den Tag über hungernd nach Hause oder
in den Jugendklub gehen müssen. Kostenlose Essensangebote gehören deshalb dazu. Diese müssen von der Stadt subventioniert und soweit möglich im
kommunalen Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Es muss immer ein vegetarisches, veganes und frisch gekochtes Angebot geben und generell soll
das Essen ökologisch, regional und saisonal angebaut sein.
Integration außerschulischer Lernorte, die in der Kommune bereitstehen
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten und -möglichkeiten (z. B. Bibliotheken, Naturlernpfaden, historische Stätten) soll verstärkt werden.
Schüler*innen muss vor allem auch über die Schule die Möglichkeit gegeben werden, einen ersten Zugang zum gesellschaftlich-kulturellen Leben zu
erhalten. Ebenso müssen Schulen aktiv in das kommunale Geschehen integriert werden. Dazu gehört auch, dass Schulgebäude stärker für öffentliche
Veranstaltungen genutzt werden. Dabei sollte die Schule zwar politisch neutral bleiben, muss sich aber zu ihren demokratischen Grundprinzipien
bekennen.
Frühkindliche Erziehung und Kindertagesstätten/Kindertagespflege
Kinder haben ein Recht auf gute Betreuung – unabhängig davon, wo sie wohnen. Doch aktuell hängt der Zugang zu Krippe und Kita stark vom Wohnort ab:
Während in Ostdeutschland über die Hälfte der Kinder unter drei Jahren betreut wird, liegt die Quote in Teilen Westdeutschlands deutlich darunter. Das
ist ungerecht und geht zulasten von Familien, insbesondere von FINTA*s, die dadurch häufiger unbezahlte Sorgearbeit leisten müssen. Wir fordern:
flächendeckende, kostenlose Betreuung und bessere Arbeitsbedingungen für Erzieher*innen. Gute Bildung braucht gutes Personal – fair bezahlt und
entlastet.
Multiprofessionelle Teams entlasten ebenso Erzieher*innen und ermöglichen eine spezifische Unterstützung kindlicher Entwicklung. Zudem ist mehr
Verwaltungspersonal in Kindergärten notwendig, damit sich Erzieher*innen wieder mehr auf ihre Hauptaufgabe fokussieren können. Der Ausbau von Kitas zu
Familienzentren bietet die einmalige Möglichkeit, vielfältige Bildungs- und Beratungsangebote für die gesamte Familie an einem zentralen Ort
bereitzustellen. Jede Kita weist andere Bedingungen auf, deswegen sollen soziale Faktoren der Kinder, Eltern und der Umgebung erfasst werden und
Berücksichtigung finden. Dazu kann auch gehören, dass Kitas eigenständige Profile herausbilden. Tagesmütter und -väter sollen eine angemessene
sozialversicherungspflichtige Absicherung erhalten. Die Neugründung von Kindertagespflegen muss unterstützt und Beratung bereitgestellt werden.
Erzieher*innen wissen viel zu oft nicht, an wen sie sich wenden können. Es benötigt sichtbare Beratungs-, Fortbildungs- und Vernetzungsangebote für
Erzieher*innen. Beim Übergang in die Grundschule darf diese nicht wieder von vorne anfangen. Vielmehr muss die Zusammenarbeit beim Übergang im Sinne
des staatlichen Bildungsplanes 0-10 verstärkt werden. Die frühzeitige Verankerung eines Bewusstseins für die Auswirkungen unserer Lebensweise ist
essenziell, deswegen sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bereits in der Kita stattfinden. B
Wir setzen uns auf Landesebene für eine einkommensabhängige Staffelung der Kita Gebühren ein, die Familien mit geringen Einkommen befreit, mittlere
Einkommen entlastet und hohe Einkommen stärker in die Verantwortung zieht.
Ausbildung
Kommunale Bildungspolitik darf nicht einseitig auf den schulischen Bildungsweg ausgerichtet sein. Jugendliche, die sich nicht für das Abitur
entscheiden oder das Studium abbrechen, müssen ebenso im Fokus sein. Fachkräfte werden dringend benötigt. Dazu gehören kommunale Arbeitsmarkt- und
Ausbildungsprogramme sowie der Aufbau entsprechender Vermittlungsnetzwerke, die Stärkung von Berufsschulen und der dualen Ausbildung, die Schaffung
von Azubi-Wohnheimen und fachspezifischer Campus für die berufliche Bildung.
Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Ein Stadtelternbeirat, eine kommunale Schüler*innenvertretung und eine Kinder- und Jugendvertretung müssen eingerichtet (sofern noch nicht vorhanden)
und unterstützt werden. Die Kinder- und Jugendvertretung soll zu kommunalen Sitzungen eingeladen und bei Anliegen angehört werden.
Auch demokratische Strukturen in der Schule oder Kita müssen gestärkt werden. Jede Schule braucht eine funktionierende und gut ausgestattete
Schüler*innenvertretung, die an Prozessen verpflichtend beteiligt werden muss. Schüler*innen brauchen ein Mitbestimmungsrecht, wenn es um ihren Alltag
in der Schule geht. Von der Pausenhofgestaltung zum Essensangebot müssen Schüler*innen ein Recht auf Mitsprache und Mitbestimmung bekommen.
Demokratische Strukturen können bereits in der Kita erlernt werden.
Inklusion
Wir gestalten ein inklusives Bildungssystem, in dem alle Kinder gemeinsam gut lernen können. Dazu braucht es vor Ort kommunale Inklusionskonzepte. Um
Familien bestmöglich zu unterstützen, sind kommunale bzw. regionale und unabhängige Beratungsangebote essenziell. In den „inklusiven Schulbündnissen“
(iSB) sollen die Kommunen als Schulträger*innen die inklusive Schulentwicklung vorantreiben. Gleichzeitig unterstützen wir Schulen dabei, sich zu
inklusiven Lernorten weiterzuentwickeln. Barrierearmut wird auch bei Sanierungen und Neubauten berücksichtigt, sodass bauliche Barrieren abgebaut und
inklusive Strukturen von Anfang an eingeplant werden. Bereits in der frühkindlichen Bildung spielt Inklusion eine entscheidende Rolle. Daher ist eine
verstärkte Kita-Sozialarbeit notwendig, um Familien frühzeitig zu begleiten und zu entlasten. Ein entscheidender Baustein für eine erfolgreiche
Inklusion sind multiprofessionelle Teams, in denen Lehrkräfte der allgemeinen Schulen, Förderpädagog*innen, Sozialpädagog*innen und
Teilhabeassistent*innen verlässlich und dauerhaft gemeinsam an der allgemeinen Schule arbeiten, sich abstimmen und gegenseitig unterstützen können.
Dabei ist es wichtig, Förderschullehrkräfte möglichst mit ihrem gesamten Stundenkontingent in das Kollegium einer allgemeinen Schule zu integrieren,
sofern sie dies wünschen. Zudem bedarf es einer besseren Organisation der Teilhabeassistent*innen, damit ihre Arbeit optimal und verlässlich auf die
Bedürfnisse der Schüler*innen abgestimmt werden kann. Wir fordern schnellstmöglich die vollständige Abschaffung des Förderschulsystems und ermöglichen
den Weg dorthin.
Herkunftsprachlicher Unterricht
Für viele Schüler*innen ist der herkunftprachliche Unterricht ein Weg die Sprache ihrer Familie zu lernen. Das macht es leichter, andere Sprachen zu
lernen und zu verstehen. Die Schulverwaltungen müssen dafür sorgen, dass genügend Lehrer*innen für den HSU gewonnen werden. Viele Eltern wissen oft
nicht, dass es herkunftssprachlichen Unterricht gibt. Daher muss intensiver dafür geworben werden, damit auch alle Eltern die Möglichkeit haben, ihre
Kinder anzumelden und auch in Zukunft mehr Sprachen angeboten werden können.
Jugendhilfe
Die Jugendhilfe benötigt einen besseren Personalschlüssel und soll durch Bürokratieabbau entlastet werden. Anstatt einzelne Genehmigungen einholen zu
müssen, wird ein Verfügungsrahmen pro Monat und Kind eingerichtet.
Kein Platz für Rechtsextremismus an Schulen
Rechtsextremismusvorfälle sind keine Einzelfälle mehr in Schulen. Der Hitlergruß im Klassenzimmer, Hakenkreuze auf dem Schulhof oder rassistische
Übergriffe auf der Klassenfahrt. Schulen müssen wieder zu sicheren Orte der Vielfalt, Toleranz und Mitbestimmung werden.Kommunen dürfen sich hier
nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir fordern, dass politische Bildung gestärkt wird, damit Schüler*innen früh lernen, demokratische Werte zu
verteidigen. Lehrkräfte brauchen klare Unterstützung im Umgang mit rechten Vorfällen. Antirassistische und Demokratiefördernde Projekte müssen aktiv
gefördert statt behindert werden. Betroffene rechter Gewalt verdienen Schutz und Solidarität. Rechte Netzwerke, die gezielt junge Menschen ansprechen,
dürfen keinen Raum bekommen – weder in der Schule noch online.